
 Themen
Themen Ökonomische Dimension von Wasserknappheit
Die bestimmende ökonomische Diskurslinie ist die Frage, wofür die knappe Ressource Wasser genutzt werden soll, gerade mit Blick auf Verteilungskonflikte.
Immer wieder werden wirtschaftliche Schäden und steigende Kosten in Folge von Dürren (und teilweise damit einhergehende Ernteausfälle) diskutiert. Die Bundesregierung betont etwa, dass Hitze und Dürre als „stille“ Extremwetterereignisse oft unterschätzt werden. Auch das PIK warnt, dass die wirtschaftlichen Schäden des Klimawandels, u. a. durch Hitze und Trockenperioden sowie Starkregenereignisse, in Europa bis zu 11 % des jährlichen Pro-Kopf-Einkommens betragen könnten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hingegen rechnet mit etwas geringeren Kosten, verweist aber dennoch auf signifikante wirtschaftliche Risiken. Vereinzelt gibt es Beiträge aus der Forschung für konkrete Fallbeispiele, etwa vom PIK zu den ökonomischen Auswirkungen von Dürren in Spanien.
Der Bauernverband konzentriert sich neben den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit auch auf den Zusammenhang zum internationalen Handel. So sei der Handel von Agrarprodukten eng verbunden mit dem Handel von “virtuellem Wasser”. Wasserintensive Landwirtschaftsprodukte sollten daher in Regionen mit wenig Wasserressourcen importiert werden. um Wasserknappheit zu verringern und positive wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium warnt in seinem Erntebericht 2024 vor Ernteverlusten durch Dürre, während der NABU auf die Wirksamkeit dürrebezogener Präventivmaßnahmen zur Risikominderung hinweist.
Mit Blick auf die Versorgung der Industrie wird aus dieser Sicht betont, dass die Industrie das Trinkwasser nicht verdrängen wolle. Die IHK Berlin stellt Informationen für Unternehmen bereit, wie diese ihren Wasserverbrauch senken können. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert eine Modernisierung des Wasserwirtschaftsrechts, die Umsetzung der EU-Richtlinie Kommunales Abwasser und Investitionen in Infrastruktur, um Trockenperioden, Starkregen und deren Folgen besser bewältigen zu können.
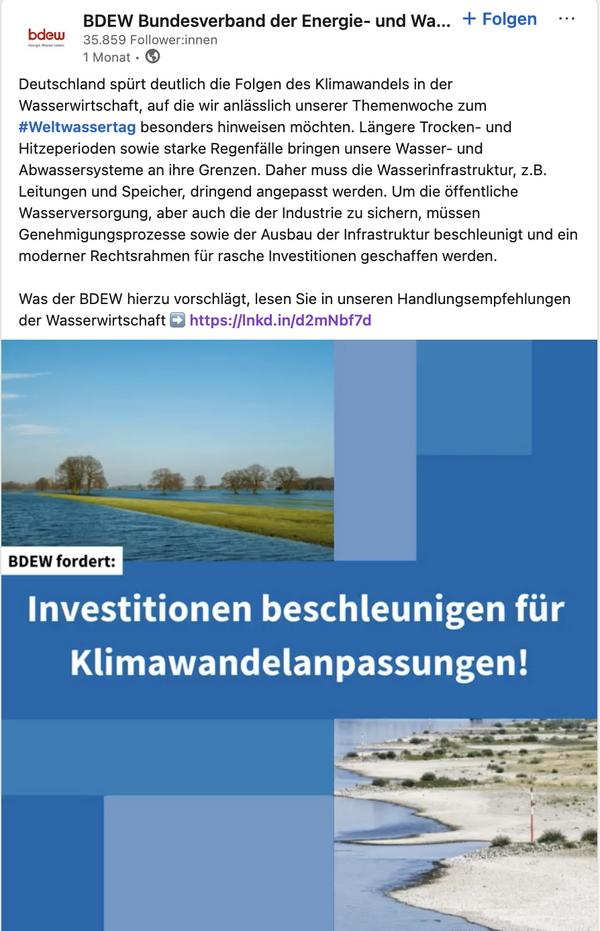
BDEW fordert Maßnahmen zu Klimawandelanpassungen [LinkedIn]
Diskussionen über den Verteilungskonflikt des knappen Guts Wasser werden u. a. vom Berliner Wassertisch behandelt, der vor Gefahren durch Privatisierungen im Wasserbereich warnt. Auch die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) fordert in einem Impulspapier Anpassungsmaßnahmen, um den Vorrang für die öffentliche Wasserversorgung bei Nutzungskonflikten mit Industrie oder Landwirtschaft zu sichern.
Insbesondere am Beispiel Tesla, aber auch durch die Red Bull-Produktion in Baruth/Mark, zeigt sich die kontrovers geführte Debatte um Wasserverbrauch der Industrie versus menschliche und ökologische Bedarfe. Als Kernprobleme gelten der Bau der Tesla-Fabrik in einem Wasserschutzgebiet, der hohe Wasserbedarf und gleichzeitig eine potentielle Wasserverschmutzung. Tesla verwendet laut eigenen Angaben viel Schmutzwasser wieder, um Frischwasser zu sparen. Insbesondere Aktivist:innen äußern sich jedoch deutlich gegen das Werk, etwa “Tesla Stoppen” mit der Protestaktion “Wasserwald”, die Bürgerinitiative Grünheide, deren Mitglied Heidemarie Schroeder sogar ein Buch zum Thema veröffentlicht hat, oder das Bündnis “Tesla den Hahn abdrehen!” aus Berliner und Brandenburger Gruppen wie der “Wassertafel”, “Sand im Getriebe” oder “Spree:publik”.