
 Themen
Themen Folgen von Wasserknappheit für Böden und Landmanagement
Sowohl global als auch lokal werden die Folgen von Dürren für die Landnutzung besprochen. Eine große PIK-Studie konzentriert sich auf die Transformation von Landmanagement, um planetare Grenzen zu beachten. Dabei wird unter einem globalen Scope untersucht, welche Auswirkungen Wasserknappheit auf Land und die menschliche Landnutzung haben kann und die integrierte Bewirtschaftung von Wasserressourcen als Faktor in der Widerstandsfähigkeit gegen Dürren hervorgehoben.
Das Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz bietet Informationsangebote und Förderberatungen für Flächeneigentümer:innen an, um Böden besser vor Erosion zu schützen und Wasserspeicherung zu ermöglichen. Insbesondere mit Blick auf Brandenburg werden Folgen von Trockenheit für die Landwirtschaft diskutiert. Die TU fällt hier durch Forschungsartikel oder das bis 2024 bestehende “WasserKultur”-Projekt auf, das exemplarische Analysen für Optimierungsvorschläge der Landnutzung und Rekultivierung in der Lausitz erforschte.
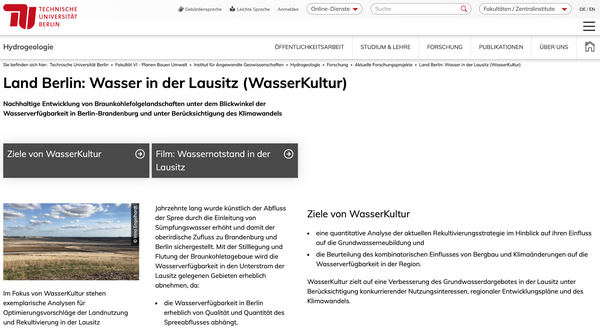
TU-Projekt “WasserKultur” zu Landnutzung und Wasserverfügbarkeit in der Lausitz
Zudem wird die Gefahr für Schwammlandschaften diskutiert. So weist Carina Darmstadt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die zu Schwammlandschaften im EU-Verbundprojekt “Spongeboost” arbeitet, auf den Verlust der natürlichen Schwammfunktion der Landschaft hin. Sie fordert “naturnahe Flusslandschaften” für Artenvielfalt, Klima und Hochwasserschutz, die sie als ebenso effektiv wie technische Lösungen einschätzt. In einem Beitrag für den Deutschen Naturschutzring argumentiert sie gemeinsam mit dem Forscher Mathias Scholz des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) für die Renaturierung von anthropogen veränderten Flusslandschaften, damit diese als Schwammlandschaften in Dürreperioden resilient sind.
Als Beispiel auf lokaler Ebene fungiert ein Projekt der FU zur Apfelwiese an der Otto-von-Simson-Straße, das sich mit der Wasseraufnahmefähigkeit auseinandersetzt. Projektleiterin Karola Braun-Wanke weist darauf hin, dass mit Grünflächen grundsätzlich biodiversitätsfreundlicher und klimaresilienter umgegangen werden müsse.